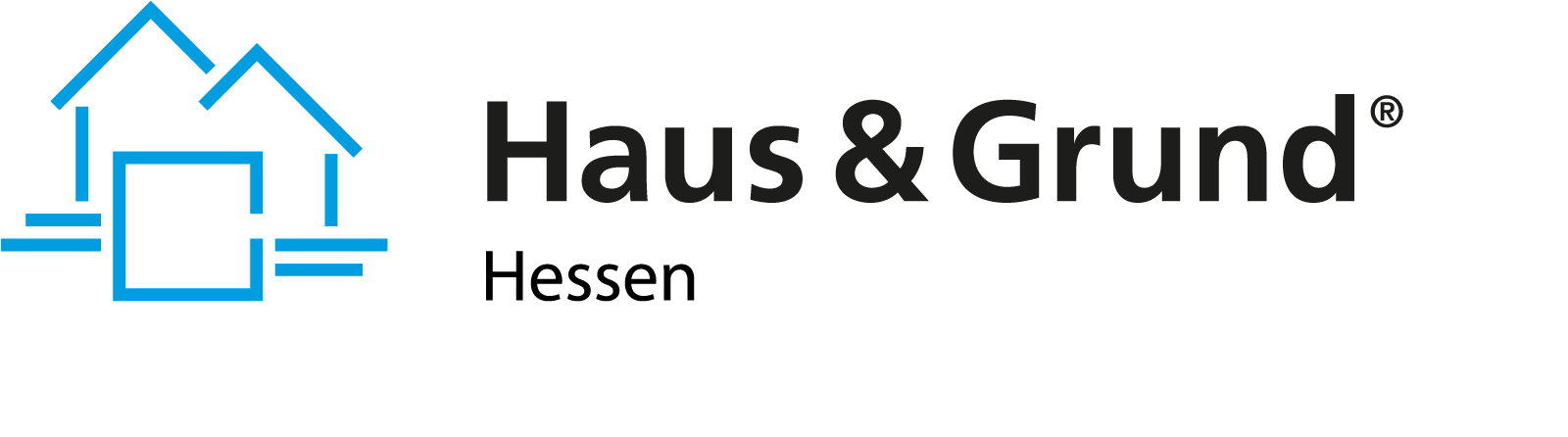


64293 Darmstadt
Tel. 06151 428690
Fax 06151 428691
» E-Mail schreiben
Mietkaution
Rechte, Pflichten und aktuelle Herausforderungen – Was Vermieter wissen sollten
Ob Wohnung, Haus oder Einliegerwohnung – die Mietkaution gehört für private Vermieter zur gängigen Absicherung im Mietverhältnis. Doch wie muss sie rechtlich korrekt behandelt werden? Was gilt bei Negativzinsen, und wer trägt eigentlich die Kontoführungsgebühren? Hier finden Sie einen Überblick über den aktuellen Stand von Rechtsprechung und Literatur.
Eine Kaution ist keine Pflicht. Vielmehr muss diese im Mietvertrag vereinbart werden. Gemäß § 551 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) darf die Kaution höchstens drei Monatskaltmieten betragen. Betriebskostenabschläge oder Vorauszahlungen bleiben bei der Berechnung außen vor. Das gilt auch bei Inklusivmieten oder Warmmieten. Der Anteil für Betriebskosten muss herausgerechnet werden. Anderslautende vertragliche Vereinbarungen sind unwirksam.
Wie muss die Barkaution angelegt werden?
Bei der sogenannten Barkaution zahlt der Mieter den Betrag auf ein vom Vermieter angegebenes Konto oder übergibt ihn in bar an den Vermieter. Wird eine Barkaution vereinbart, verpflichtet das Gesetz den Vermieter dazu, diese
- getrennt von seinem eigenen Vermögen zu verwahren,
- auf einem Konto mit marktüblicher Verzinsung anzulegen,
dies hat wie bei einem Sparbuch mit dreimonatiger Kündigungsfrist (§ 551 Absatz 3 Satz 1 BGB) zu erfolgen.
Der Vermieter wird damit zum Treuhänder. Das ist eine Rolle, die Sorgfalt vom Vermieter verlangt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dies mit Beschluss vom 9. Juni 2015 (VIII ZR 324/14) bestätigt: „Der Vermieter hat die Kaution getrennt von seinem Vermögen anzulegen, um zu gewährleisten, dass der Mieter im Fall der Insolvenz des Vermieters seine Kaution ungeschmälert zurückerhält.“
Sammelkonto ist erlaubt, aber nicht ohne Bedingungen
Wer mehrere Wohnungen vermietet, muss nicht für jede Kaution ein eigenes Konto führen. Ein Mietkautions-Sammelkonto ist zulässig, wenn:
- buchhalterisch klar trennbar ist, welche Summe welchem Mieter gehört,
- ein Treuhandkonto genutzt wird,
- die Zinsen anteilig dem jeweiligen Mieter gutgeschrieben werden
- und das Konto entsprechend gekennzeichnet ist.
Ein Privat- oder Geschäftskonto reicht nicht aus. Die Kaution darf nicht mit Mieteinnahmen vermischt werden.
Wer zahlt die Kontogebühren und gegebenenfalls Negativzinsen?
Diese Frage wird intensiv diskutiert. Eine höchstrichterliche Entscheidung steht noch aus.
Da der Vermieter nur Treuhänder ist, muss der Mieter die Gebühren des Mietkautionskontos tragen. Diese Auffassung vertritt auch Mietrechtsexperte Dr. Tobias Weber in der „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (ZMR 2021, 945). Eine Ausnahme sei nur bei der Zinsabschlagsteuer denkbar, wenn der Vermieter den Treuhandcharakter gegenüber dem Finanzamt nicht offenlegt.
Bezüglich Verwahrentgelten, den sogenannten Negativzinsen, vertritt Rechtsanwalt Michael Drasdo in der „Neuen Juristischen Wochenzeitschrift“ (NJW-Spezial 2022, 161) folgende Auffassung: Solange Verwahrentgelte nicht marktüblich sind, müsse der Vermieter als Treuhänder die Bank wechseln. Sobald aber Marktüblichkeit eingetreten ist, könne ein Kautionsverlust nicht mehr dem Vermieter angelastet werden; der Mieter trägt dann das wirtschaftliche Risiko. Eine Pflicht zur Wiederauffüllung der Kaution durch den Mieter könne sich ergeben, wenn die Kautionssumme durch Gebühren unterschritten wird.
Zugriff während des Mietverhältnisses nur im Ausnahmefall
Ein Zugriff des Vermieters auf die Kaution ist nur zulässig, wenn
- der Anspruch des Vermieters unbestritten ist, oder
- er rechtskräftig durch ein Gericht festgestellt wurde.
Bei streitigen Forderungen, zum Beispiel wenn der Mieter im Zuge einer Mietminderung weniger Miete zahlt, ist der Zugriff des Vermieters auf die Kaution ausgeschlossen. Der BGH entschied in seinem Urteil vom 7. Mai 2014 (VIII ZR 234/13) eindeutig: Auch eine gegenteilige Regelung im Mietvertrag ist unwirksam. Greift der Vermieter unberechtigterweise auf die Kaution während des Mietverhältnisses zurück, hat der Mieter sogar einen Anspruch gegen den Vermieter, diese wieder gutzuschreiben, so der BGH.
Wiederauffüllung durch den Mieter
Hat der Vermieter die Kaution zu Recht in Anspruch genommen, darf er vom Mieter verlangen, diese wieder bis zur vollen Höhe aufzustocken. Zahlt der Mieter trotz Fristsetzung nicht, kann dies zur fristlosen Kündigung führen (§§ 543 Absatz 1, 569 Absatz 2a BGB).
Rückzahlung der Kaution nach Mietende
Die Rückzahlung erfolgt nicht sofort nach der Beendigung des Mietverhältnisses, sondern erst nach einer angemessenen Prüf- und Überlegungsfrist. Die Rechtsprechung billigt dem Vermieter hierfür bis zu sechs Monate zu (§ 548 Absatz 1 BGB). In dieser Zeit muss der Vermieter über die Kaution abrechnen. Bei einer noch nicht erfolgten Betriebskostenabrechnung darf ein angemessener Teil der Kaution einbehalten werden, wenn mit Nachforderungen zu rechnen ist. Dieser Teil darf zurückgehalten werden, bis die Abrechnung vorliegt (BGH, Urteil vom 18. Januar 2006, VIII ZR 71/05).
Kommentar von Inka-Marie Storm, Chefjustiziarin
„Die Barkaution ist in § 551 BGB klar geregelt und nach wie vor eines der klassischen Sicherungsmittel im Mietverhältnis. Für Vermieter bietet sie den Vorteil, dass sie – im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen – vergleichsweise unkompliziert auf die Sicherheitsleistung zugreifen können. Zudem ist der Umgang mit Barkautionen rechtlich gut etabliert, was für Klarheit und Rechtssicherheit sorgt.
In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderer Trend: Immer weniger Banken bieten klassische Mietkautionskonten an oder nur zu sehr ungünstigen Konditionen. Gründe dafür sind insbesondere die seit Jahren niedrigen oder gar negativen Zinsen sowie gestiegene regulatorische Anforderungen. Die Eröffnung und Führung solcher Treuhandkonten ist für viele Kreditinstitute wirtschaftlich nicht mehr lohnend.
Alternativen zur Barkaution gewinnen daher an Bedeutung, darunter:
- Mietbürgschaften (zum Beispiel durch Banken oder Versicherungen),
- Kautionsversicherungen (häufig in Form von jährlichen Prämienzahlungen),
- Verpfändung von Sparkonten oder Wertpapieranlagen.
Diese Alternativen sind oft mit weniger Verwaltungsaufwand verbunden und bieten auch dem Mieter Vorteile, etwa in Form von Liquiditätserhalt. Allerdings ist ihre Akzeptanz bei privaten Vermietern unterschiedlich, und die rechtlichen Anforderungen insbesondere bei der Verpfändung sind teils komplexer.“
